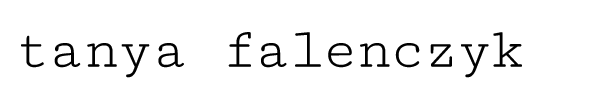Text:
Tanya Falenczyk
Grafik:
Molly Rose Dyson
Erschienen in:
ZEIT Campus Nr.2/2020
Text:
Tanya Falenczyk
Grafik:
Molly Rose Dyson
Erschienen in:
ZEIT Campus Nr. 2/2020
Hier rein, da raus
Großbritannien stimmte im Sommer 2016 für den Brexit. Ein historischer Moment, zum ersten Mal seit der Gründung 1951 verließ ein Mitglied die Europäische Union. Auf den Schock folgte Verunsicherung: Wie wird der Ausstieg geregelt? Seitdem profitieren Beratungsfirmen von ratlosen Politikern und Unternehmern. Allein die britische Regierung soll für sie im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr ausgegeben haben, rund 548 Millionen Euro.
Zwei Berater, Sebastian Ellard, 26, und Ann-Kathrin Hörster, 29, arbeiten in Brexit-Teams und erzählen unabhängig voneinander, wie sie den Austritt erlebt haben.
26. Juni 2016: Tag des Referendums. Die
eine Seite kämpft für »Remain«, die andere für »Leave«. Am Ende stimmen 17,4 Millionen Briten für den Brexit. Am Tag danach tritt Premierminister David Cameron, der sich für den Verbleib in der EU eingesetzt hatte, zurück.
Ann-Kathrin: Damals hatte ich gerade in Münster meinen Master in VWL gemacht und meine Masterarbeit über die Auswirkungen des Trennbankengesetzes vor dem Hintergrund der europäischen Finanzmarktintegration abgegeben. Am Morgen nach dem Referendum lag ich im Bett, checkte die Nachrichten auf meinem Handy und dachte: »Das kann doch nicht wahr sein.« Danach habe ich direkt eine Freundin aus der Uni angerufen, sie wollte für ihr Studium noch für ein Jahr nach London. Wir waren beide traurig.
Sebastian: Mein Vater ist Brite, mit ihm war ich oft in England, wo wir Verwandte in Kent besucht haben. Ich selbst durfte aber nicht abstimmen. Ich habe in der Zeit öfter mit meiner Oma über den Brexit gesprochen. Sie hat den Zweiten Weltkrieg in London erlebt und konnte nicht glauben, was passiert war. Sie hat sich große Sorgen gemacht, dass sich die europäischen Länder wieder voneinander entfernen, weil anscheinend so viele Briten nationalistisch denken.
Ann-Kathrin: Am schlimmsten fand ich den Gedanken, nicht mehr uneingeschränkt reisen zu können. Ich halte es für eine der besten Errungenschaften der europäischen Union, dass wir wegen des Schengen-Abkommens frei durch die EU reisen dürfen. Als ich VWL studierte, habe ich außerdem gelernt, wie wichtig der freie Handel innerhalb der EU für die Mitgliedsländer ist.
Sebastian: Im ersten Moment dachte ich noch: »Erst mal abwarten!« Ich habe gehofft, dass es zu einem zweiten Referendum kommen würde. Ich kenne die Europäische Union nur wachsend, nicht schrumpfend.
Ann-Kathrin: In den fünf Jahren meines Studiums habe ich mich mit dem Finanzwesen beschäftigt, war in der Summer School der Copenhagen Business School, habe Praktika in der spanischen Außenhandelskammer und den internationalen Finanzinstituten wie der Deutschen Bank gemacht. Als die Briten für den Brexit abgestimmt haben, habe ich darüber nachgedacht, welche Konsequenzen das für meine spätere Arbeit haben würde.
13. Juli 2016: Theresa May wird Premierministerin.
29. März 2017: Theresa May setzt Artikel 50 des Lissabon-Vertrages
in Kraft, der den Austritt eines Mitgliedes aus der EU regelt und
den Countdown bis zum Brexit offiziell startet. In zwei Jahren soll Großbritannien aus der EU austreten.
Sebastian: Ich bin seit Dezember 2018 bei der Unternehmensberatung Deloitte. Im Januar 2019 kam ich ins Brexit-Team. Das war gleich mein erstes Projekt. Ich wurde ausgewählt, weil ich fließend Englisch spreche und mich außerdem im Finanzbereich schon gut auskannte. Im Detail darf ich nicht darüber sprechen, was meine Kollegen und ich machen. Das ist Geschäftsgeheimnis. Ich kann aber sagen: Ich berate einen Kunden zum Beispiel bei Eigenheiten der deutschen Steuergesetzgebung und beim Client Onboarding. Das heißt, mein Team und ich helfen dem Finanzinstitut, seine Großkunden nach Frankfurt zu verlagern und dort neu anzubinden.
Ann-Kathrin: Mit Banken und dem Brexit hatte ich schon in meinem vorherigen Job zu tun. Seit einem Jahr bin ich bei PwC im Brexit-Team und berate mit meinen fünf Kollegen eine Bank, die ihren Sitz in London hatte und nun nach Frankfurt umzieht. Dafür ist es wichtig, dass sie die Regularien der deutschen Finanzaufsichtsbehörde erfüllt. Es ist zum Beispiel Pflicht, dass eine Bank sich auf einen Krisenfall wie einen Hackerangriff vorbereitet, indem sie ein sogenanntes Bankentestament ausarbeitet. Das ist eine Art Notfallplan, der verhindern soll, dass Banken durch ihre eigene Insolvenz eine internationale Finanzkrise auslösen. Darin steht etwa, welche Tochterunternehmen oder Aktienanteile sie im Notfall verkaufen könnten.
8. Juni 2017: Vorgezogene Wahlen in Großbritannien. Theresa May wollte ihre Autorität während der Brexit-Verhandlungen erhöhen, verliert aber ihre Mehrheit im Parlament.
8. Dezember 2017: Im britischen Parlament gibt es Streit über die Konditionen des Brexits. Vor allem um den sogenannten »Backstop«, der verhindern soll, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland zur Zollgrenze wird.
Sebastian: Wir Berater müssen die Nachrichten kennen und wissen, was auf unsere Kunden zukommt. Ich benutze dafür zum Beispiel Factiva von Dow Jones. Das ist ein Zeitungskiosk, der mir alle wichtigen Artikel zu Finanzen, Wirtschaft und Politik ausspuckt. Meine Kollegen haben mir vor dem neuen Auftrag auch ein Briefing gemailt, mehrere Hundert Seiten. Darin stehen dann die wichtigsten Infos über unsere Kunden und welche Probleme wir angehen.
Ann-Kathrin: Bei uns gibt es ein Expertenteam zum Brexit, das ständig neue Entwicklungen beobachtet und uns dann eine Zusammenfassung schickt. PwC veröffentlicht zum Beispiel auch Podcasts zu dem Thema, die höre ich mir an.
25. November 2018: Die EU billigt das Abkommen für den Austritt.
Sebastian: Auf einmal waren es nur noch zwölf Monate bis zum geplanten Termin im März 2019, dann nur noch zehn. Es gab immer noch keine politische Einigung über die Brexit-Konditionen. Und die Unternehmen wurden nervös. Sie rechneten rückwärts: Wie viele Monate vorher müssen sie damit anfangen, Prozesse umzustellen? Welche neuen Anforderungen, zum Beispiel in steuerlicher Hinsicht, werden relevant? Die meisten Unternehmen haben zu dem Zeitpunkt die Reißleine gezogen: Viele Unternehmen verhielten sich so, als ob der Brexit kommen würde.
15. Januar 2019: Theresa May versucht, ihren Brexit-Deal im britischen Parlament durchzusetzen. Wegen der Uneinigkeit über den Backstop verliert sie die Abstimmung so hoch wie noch keine andere verloren wurde. Zwei Monate später verliert sie wieder.
Ann-Kathrin: Uns fehlte die Planungssicherheit. Für meine Arbeit brauche ich verlässliche Informationen und Daten, um voraussehen zu können, wohin die Reise für meine Mandanten geht. Das größte Problem der Banken war, dass sie in Frankfurt schnell Personal finden mussten und ein neues Bürogebäude.
Sebastian: Kurz vor dem vermeintlichen Austrittstermin im März hatten wir im Team eine sehr intensive Phase von ungefähr zwei Wochen. Wir haben in den Mittagspausen schnell gegessen und vier, fünf Tage lang erst nach Mitternacht Feierabend gemacht. Das war aufregend und hat uns als Team zusammengeschweißt. Wir wollten die Deadline unbedingt schaffen.
20. März 2019: Theresa May bittet die EU um einen Aufschub. Der Austrittstermin wird zuerst auf den 12. April 2019 verlegt, in der Nacht vom 10. April dann noch mal auf den 31. Oktober 2019.
Sebastian: Als es den ersten Aufschub gab, waren viele andere Unternehmen erleichtert. Sie waren nicht bereit. Viele sind es noch immer nicht.
…
Der vollständige Text ist in der Ausgabe 02/2020 von ZEIT Campus erschienen.