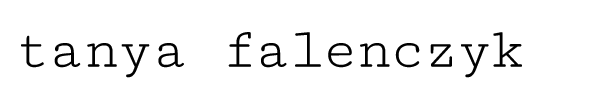Text:
Tanya Falenczyk
Erschienen in:
ZEIT Campus Nr. 6/2019
Text:
Tanya Falenczyk
Erschienen in:
ZEIT Campus Nr. 6/2019
»Ich verteidige den Täter,
nicht die Tat«
Mutmaßliche Terroristen, Vergewaltiger oder Kindsmörder: Diese drei Anwälte verteidigen Menschen, auf deren Seite fast niemand mehr steht. Warum machen sie das?
Mathias Grasel verteidigt Beate Zschäpe
Auf der Tribüne im Saal A101 des Münchner Oberlandesgerichts drängen sich am 9. Dezember 2015 knapp hundert Zuschauer und Journalisten. Es ist der 249. Tag des NSUProzesses. Viele Beobachter glauben, es könnte der wichtigste werden. Der Strafverteidiger Mathias Grasel, 31, wird die Aussage seiner Mandantin Beate Zschäpe vorlesen, die 248 Verhandlungstage lang geschwiegen hat. »Ich wurde am 2. Januar 1975 als Beate Apel in Jena geboren«, liest Grasel.
Der NSU-Prozess war der größte Prozess der jüngeren deutschen Geschichte. Es ging um zehn rechtsterroristische Morde, zwei Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle sowie 43 Mordversuche des »Nationalsozialistischen Untergrunds«, kurz NSU. Die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen sich 2011 auf der Flucht. Beate Zschäpe blieb zurück und steckte die gemeinsame Wohnung in Brand, wohl um Beweise zu vernichten. Anschließend verschickte sie Bekennervideos, in denen die Opfer verhöhnt wurden.
Als Mathias Grasel die Aussage von Beate Zschäpe vorliest, läuft der Prozess bereits seit drei Jahren. Grasel war aber nicht von Anfang an dabei, sondern kam erst nach zweieinhalb Jahren dazu. Warum entscheidet sich ein Anwalt, das Mandat eines NSU-Mitglieds zu übernehmen? Und wie denkt er heute über den Prozess?
Grasels Kanzlei liegt zehn Minuten vom Oberlandesgericht entfernt, dort sitzt er hinter einem glänzenden Holztisch. Er ist inzwischen 35 Jahre alt, trägt eine randlose Brille und einen Nadelstreifenanzug mit roter Krawatte, in seine Manschettenknöpfe ist ein »M« graviert. Grasel erzählt gern, warum er Anwalt wurde: Als er 16 Jahre alt war, schlug ihm auf dem Weg zum Taekwondo-Training in seiner Heimat am Bodensee ein Junge ins Gesicht. Der Junge war wegen eines Mädchens eifersüchtig und brach ihm die Nase. Grasel zeigte ihn wegen Körperverletzung an und war fasziniert vom Rechtssystem. Statt Chemie studierte er Jura und wurde Strafverteidiger.
»Heute bin ich dem Menschen dankbar, dass er mir die Nase gebrochen hat«, sagt Grasel. Für viele Juristen habe das Strafrecht etwas Anrüchiges. Dabei sei es wichtig, dass es Verteidiger gebe, die Beschuldigten im Kampf gegen die Übermacht der Strafverfolgungsbehörden helfen. Grasel spricht monoton und bedächtig, vieles klingt wie vorgelesen. In einem Interview wäre er mal damit zitiert worden, dass ihm etwas »wurscht« sei, seitdem sei er vorsichtig, sagt er.
»Wir haben uns gut verstanden und tun das bis heute. Wenn sie in Freiheit wäre, würde ich auch ein Bier mit ihr trinken gehen«
Es war eine Reihe ungewöhnlicher Umstände, die ihn zum Verteidiger von Beate Zschäpe machte. Erst zerstritt sich die Angeklagte mit ihren Pflichtverteidigern Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm, weil sie aussagen wollte, die Anwälte ihr aber davon abgeraten hatten. Dann suchte sie sich einen neuen Anwalt. Ein Mithäftling in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim empfahl ihr einen erfahrenen Strafverteidiger, der wollte den Fall aber kurz vor seiner Rente nicht mehr übernehmen. Er schlug seinen Kollegen Grasel vor.
Grasel besucht Zschäpe dreimal in der Justizvollzugsanstalt, wägt ein paar Tage ab, was das für seine Freundin und ihn bedeuten würde und ob es »Anfeindungen aus dem linken Flügel« geben könne. Dann entscheidet er sich dafür. »So ein Verfahren bekommt man nur einmal im Leben. Ich wollte mich der Herausforderung stellen«, sagt Grasel. Er kümmerte sich in den vier Jahren, die er davor als Anwalt arbeitete, um Fälle wie Raub oder Steuerhinterziehung.
Für ihn sei es nicht relevant gewesen, dass es im Prozess um brutale, rechtsextreme Taten ging, sagt Mathias Grasel. »Ich verteidige den Täter, nicht die Tat.« Jeder Mensch habe das Recht auf Verteidigung. So sieht er das.
Als Grasel im Juli 2015 in den Prozess einsteigt, waren schon viele Prozesstage vergangen. Grasel war nicht dabei, als der Vater eines Opfers sich vor Zschäpe auf den Boden legte, um ihr zu zeigen, wie er seinen sterbenden Sohn fand. Auch nicht, als ein anderer Zeuge von einem Spiel erzählte, das Zschäpe gebastelt habe: »Pogromly«, eine verdrehte Version von Monopoly, der Name ist eine Anspielung auf die Reichspogromnacht 1938.
Insgesamt 50 Gigabyte an Akten musste Grasel nacharbeiten. Allein die Anklageschrift hatte mehr als 488 Seiten. Das Gericht legt dafür nur eine Woche Pause ein. Heer, Stahl und Sturm weigern sich, ihm ihre Mitschriften der Prozesstage zu geben. Also arbeitet er wochenlang zwölf Stunden am Tag, auch an Wochenenden.
»Ich hatte vorher wenig gelesen von all den ›Dönermord‹-Schlagzeilen, ich konnte unvoreingenommen den Menschen Beate Zschäpe kennenlernen«, sagt Grasel. Wenn er von Zschäpe spricht, klingt er, als rede er von einer guten Bekannten, die er beschützen will, und nicht von einer Frau, die unter anderem eine Garage anmietete, in der vier Rohrbomben gefunden wurden.
Viele Reporter nennen Grasel bald den »Zschäpe-Flüsterer«. Während Zschäpe ihre anderen Anwälte nicht einmal mehr grüßt, beantwortet sie alle Fragen, die er zum Prozess hatte. Der steht bald als einziger der vier Verteidiger auf, um Zschäpe vor den Fotografen im Gerichtssaal abzuschirmen.
Jede Bewegung von Grasel bekommt an diesen Prozesstagen eine Bedeutung. Wenn er in der Pause als Einziger im Gerichtssaal bleibt, während die anderen Verteidiger nach draußen gehen, ist er für die Süddeutsche Zeitung ein »einsamer Mann«. Wenn Grasel und Zschäpe flüstern oder er ihr Gummibärchen und Schokolade in den Gerichtssaal mitbringt, ist das für die Frankfurter Rundschau ein »Flirt«. »Die Aufmerksamkeit habe ich unterschätzt«, sagt Grasel. Er scheint sich noch immer über die Schlagzeilen zu ärgern und zieht die Stirn in Falten. Er sagt, er sei nicht mit den anderen Verteidigern vor die Tür gegangen, weil er eben Nichtraucher sei. Und er wisse, dass Zschäpe aufmerksamer sei, wenn sie ab und an etwas Süßes esse.
93-mal besucht Grasel seine Mandantin in der Münchner JVA, rund 300 Stunden hat er dort mit ihr verbracht, das hat er neulich ausgerechnet. Dabei meint er, »nie eine rechte Gesinnung« festgestellt zu haben. Die rechte Gesinnung habe Zschäpe schon vor Jahren abgelegt, wann genau, könne er nicht sagen. Auf diese Argumentation stützte sich seine Verteidigung, er vertritt sie noch immer. »Wir haben uns gut verstanden und tun das bis heute. Wenn sie in Freiheit wäre, würde ich auch ein Bier mit ihr trinken gehen, kein Thema«, sagt Grasel.
Als er am 9. Dezember 2015 im vollen Gerichtssaal rund 90 Minuten lang Zschäpes Aussage vorliest, ist es still. Zschäpe habe nie gewusst, wenn die Männer, mit denen sie zwölf Jahre im Untergrund lebte, wieder Morde, Bombenanschläge und Raubüberfälle planten. »Ich war unglaublich enttäuscht darüber, dass sie erneut gemordet hatten«, liest Grasel vor und weiter: »Weder an der Vorbereitung noch an der Durchführung war ich beteiligt.«
Zschäpes Aussage sei ein »Schlag ins Gesicht gewesen«, verkündeten die Angehörigen der Opfer später über ihre Anwälte. Sie hatten auf Antworten gehofft: Warum gerade meine Mutter, mein Bruder oder mein Sohn? Nichts.
An der Aussage habe er vier Monate lang gefeilt, er konnte den Text praktisch auswendig, sagt Grasel. Er beschreibt Zschäpe darin als Frau, die aus Liebe und Alternativlosigkeit bei den Mördern blieb, weil die ihr angedroht hätten, sich umzubringen, würde sie zur Polizei gehen. Das Gericht folgt dieser Version nicht. Beate Zschäpe wird im Juli 2018 des Mordes in zehn Fällen, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen schwerer Brandstiftung schuldig gesprochen. Sie bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld.
…
Ali Aydin kämpft vor Gericht für mutmaßliche IS-Terroristen
Es ist ein heißer Tag im Juli, die Luft im Münchner Oberlandesgericht steht. Der Strafverteidiger Ali Aydin, 36, hört mit gelassenem Gesichtsausdruck zu, wie die wichtigste Zeugin gegen seine Mandantin aussagt. Die Anklage: Die 28-jährige Jennifer W. soll vor fünf Jahren in den Irak und nach Syrien gereist sein, um sich dort der Terrormiliz »Islamischer Staat« anzuschließen. Ihr wird vorgeworfen, zusammen mit ihrem damaligen Ehemann eine Jesidin und ihre fünfjährige Tochter versklavt zu haben. Der Mann soll das Mädchen über mehrere Stunden im Hof des Hauses gefesselt haben, wo es in der Sonne verdurstete. Jennifer W. droht lebenslange Haft wegen Mordes durch Unterlassen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.
Seit fünf Jahren verteidigt Aydin ausschließlich mutmaßliche islamistische Terroristen. Seine Mandanten sollen für den IS in den Krieg gezogen sein oder Bombenattentate geplant haben. Doch wie verteidigt man jemanden, der im Ausland möglicherweise zum Täter geworden ist? Und wie geht Aydin damit um?
An sein erstes Verfahren mit einem Terrorvorwurf kam Aydin durch Zufall. Nach dem Studium machte er drei Jahre nur »Wald und Wiese«, wie er es nennt. Morgens eine Scheidung, mittags einen Mietstreit, abends einen Fahrraddiebstahl. Bis der Nachbar eines Kollegen festgenommen wurde. Ihm wurde vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Aydin übernahm, weil seinem Kollegen das Verfahren »zu heiß« gewesen sei. »Es hat mich gereizt. Das war ein Verfahren mit einer anderen Qualität«, sagt Aydin. Er meint damit auch: Haftbefehle vom Bundesgerichtshof oder Anklagen vom Generalbundesanwalt. Danach hat Aydin weitere Verfahren wie dieses angenommen. Er sagt, kaum jemand habe in seinem Alter schon so viel Erfahrung an Oberlandesgerichten wie er.
»Meine Mandanten kamen nicht als Monster auf die Welt. Da ist im Leben was schiefgelaufen, und dann kamen Rattenfänger und haben sie geschnappt.«
In der Verhandlungspause sitzt Aydin in der Kantine des Strafjustizzentrums in München. Er spricht schnell, so als wäre er im Kopf immer schon ein paar Sätze weiter. Vielleicht, weil er tatsächlich ständig zu wenig Zeit hat. »Ich kann pro Jahr nur etwa zehn Fälle annehmen, weil die Verfahren meist mehr als 100 Verhandlungstage dauern.« Anwälte mit anderen Schwerpunkten würden oft bis zu 200 schaffen. Der IS gilt an vielen Orten als besiegt, aber seine Kämpfer gibt es immer noch. Etwa 60 deutsche IS-Anhänger sitzen in Syrien und im Irak im Gefängnis. Dort droht ihnen die Todesstrafe, sagt Aydin. Im Juni hat er deswegen die Bundesregierung verklagt. Er will, dass sie die IS-Anhänger zurück nach Deutschland holt, um ihnen hier einen fairen Prozess zu ermöglichen.
Viele verstehen nicht, dass er sich als Muslim auf die Verteidigung von mutmaßlichen IS-Kämpfern spezialisiert hat. Auf Facebook hat Aydin einen Artikel über Jennifer W. gepostet, darunter kommentiert jemand: »Kommt dieses Engagement für die IS Terroristen wegen des Geldes oder teilt ihr euch da eine Ideologie??« Mit solchen Sprüchen komme er zurecht, sagt Aydin. Aber vor Gericht fühle er sich oft als Einziger auf der Seite seiner Mandanten. »Terrorverdächtige haben keine Lobby, wirklich jeder Bürger wünscht sich, dass die alle möglichst hart bestraft werden«, sagt Aydin. Er sieht seine Aufgabe darin, das zu verhindern. Die Anklageschriften sind oft nicht nur ein paar Seiten lang, sondern mehrere Hundert. Meistens sind die Anschuldigungen nicht aus der Luft gegriffen. Oft gibt es WhatsApp-Verläufe oder sogar Fotos, die die Zeit beim IS belegen. Aber weil die mutmaßlichen Taten im Ausland geschehen sind, ist die Beweislage oft ein Puzzle. »Die Ermittlungsbehörden picken sich dann mit der Pinzette kleine Teile raus und interpretieren sie«, sagt Aydin.
Oftmals gibt es bei den Prozessen keine Zeugen. Im Fall von Jennifer W. schon. Die Mutter des getöteten Kindes wurde aus dem Irak eingeflogen und ins Münchner Oberlandesgericht gebracht. Mit einer Übersetzerin macht sie ihre Aussage. Sie berichtet, wie sie Jennifer W. angefleht habe, die Fesseln ihrer Tochter zu lösen. Wie der Ehemann das Mädchen irgendwann befreite, doch da sei es schon blass und steif gewesen.
Aydin hört zu, verzieht keine Miene und macht sich ab und zu Notizen. Er sagt, er habe in den vergangenen Jahren einen Abwehrmechanismus entwickelt, wie ein Arzt, der Patienten verliere und eine Stunde später Witze mache. »Viele Sachen berühren mich
nicht mehr so sehr, und ich bin weniger zu schockieren.« Das sei ihm gar nicht aufgefallen, bis Freunde ihn darauf aufmerksam gemacht haben. Er sagt, das gefalle ihm nicht, aber für seinen Job müsse es so sein. Ein paar Prozesstage später wird Aydin die Mutter des toten Mädchens befragen und nach Widersprüchen in ihren Aussagen suchen. »Ich weiß, dass ich mich damit im Gerichtssaal nicht beliebt mache«, sagt er.
…
Arabella Pooth zieht für mutmaßliche Vergewaltiger und Kindesmörder vor Gericht
Eine junge Frau kommt in den Gerichtssaal in Bochum. Sie trägt ein T-Shirt, auf das ein Foto ihrer kleinen Tochter gedruckt ist. In der Hand hält sie ein Kuscheltier, einen schwarzen Raben. So erinnert sich die Strafverteidigerin Arabella Pooth, 36, an ihren schwierigsten Prozess. Unter Tränen erzählt die junge Frau drei Verhandlungstage lang, wie sie an einem Morgen im November 2014 ihre zweijährige Tochter Swetlana tot in deren Bett gefunden hatte. Und warum sie glaubt, dass ihr damaliger Lebensgefährte das Kind in der Nacht erstickt hat. Die Frau will, dass der Mann dafür bestraft wird. Die Öffentlichkeit will das auch, die Bild nannte ihn schon zu Prozessbeginn einen »KinderMörder«. Nur Arabella Pooth versucht, eine Strafe für den Mann zu verhindern.
»Wie können gerade Sie als Frau so jemanden verteidigen?«, ruft ihr die Mutter einer Zeugin im Gerichtssaal zu, erzählt Pooth heute, vier Jahre später. Es ist eine Frage, die ihr in den sechs Jahren, die sie diesen Job jetzt macht, immer wieder Freunde, Bekannte oder Zeugen gestellt haben: Warum verteidigt sie mutmaßliche Mörder, Vergewaltiger und Männer, die Kinder missbraucht haben?
Nach einem Vormittag im Amtsgericht Dortmund geht Pooth zurück in ihr Dortmunder Büro. Sie tauscht High Heels gegen weiße Sneakers und setzt sich auf einen weißen Lederstuhl. Ihren Blazer hängt sie über die Lehne, ihr Smartphone legt sie auf den Glastisch, es klingelt ständig.
»Tötungsdelikte sind wie Jura am Hochreck. Ich sehe einen harten Fall als sportlichen Wettkampf mit der Staatsanwaltschaft.«
Mörder seien keine besonders bösen Menschen, sagt Pooth. »Die sind oft 30, 40 Jahre ganz normal, bis sie aus dem Affekt heraus etwas Schlimmes tun.« Deswegen falle es ihr nicht schwer, sie zu verteidigen. Und deswegen habe sie auch nie Angst vor ihren Mandanten. Selbst dann nicht, wenn ihnen besonders brutale Taten vorgeworfen werden wie Kindsmord oder Vergewaltigung. Sie hat viele grausame Tatortfotos gesehen. »Aber ich lasse diese schrecklichen Dinge nie so weit in meinen Kopf, dass ich zu Hause im Bett noch darüber nachdenke«, sagt Pooth. Sie lächelt so zufrieden, wenn sie von ihrer Arbeit spricht, dass man ihr diese Abgeklärtheit glauben will.
Aber warum sucht sie sich ausgerechnet jene Mandanten aus, um die andere Anwältinnen und Anwälte einen Bogen machen?
»Tötungsdelikte sind Jura am Hochreck«, sagt Pooth. Die Prozesse könnten sich jeden Moment drehen, man müsse schnell auf Situationen reagieren können, jedes Mal perfekt vorbereitet sein. »Ich sehe einen harten Fall als sportlichen Wettkampf mit der Staatsanwaltschaft.«
Auch der Fall des toten Mädchens aus Bochum verlangte ihr einiges ab. Die Aussage der Mutter »fand ich ergreifend und traurig«, sagt Pooth. Aber wenn sie Zeugen befrage, könne sie auf ihr Mitgefühl keine Rücksicht nehmen. »Dann muss ich schnell umschalten und mich daran erinnern, dass das eine Zeugin ist, die möglicherweise meinen Mandanten belastet.« Nach der Aussage der Mutter sei die Stimmung im Saal bereits gegen ihren Mandanten gewesen, sagt Pooth. Dann beschuldigte der auch noch seinen 14-jährigen Sohn, das Mädchen umgebracht zu haben. Pooth sagt dazu nur: »Ich hätte den Sohn nicht so aktiv belastet.«
Das Bild, das Zeugenaussagen vor Gericht vom Angeklagten zeichneten, wurde immer düsterer: Er habe früher Katzen gequält, eine Frau vergewaltigt, das Mädchen möglicherweise aus Rache getötet, weil die Mutter nicht mit ihm nach Holland ziehen wollte.
Manche Mandanten, die dank ihrer Verteidigung freigesprochen wurden, hält Pooth selbst für schuldig. Sie findet das nicht schlimm. »Den Täter müssen Staatsanwälte und Richter überführen, das ist nicht meine Aufgabe.« Würde eine Verteidigerin dem Gericht belastende Informationen über ihre Mandantin weitergeben, würde sie sich strafbar machen.
Einen Grundsatz ihrer Verteidigung hat Pooth kürzlich auf Instagram gepostet, unter einem Selfie mit Hosenanzug und weißer Handtasche: #mitderpolizeiwirdnichtgesprochen. Am besten sei es, der Mandant sage erst vor Gericht aus oder überhaupt nicht, sagt sie. Ein weiterer Grundsatz: Anders als andere Anwälte spricht Pooth mit Journalisten, trotz Schlagzeilen wie jene in der Bild. »Die Presse schreibt ja sowieso über meinen Mandanten. Da ist es mir lieber, ich komme in dem Bericht wenigstens zu Wort.«